| |
|
| |
|
|
|
Father
John Staudenmaier: Detroit,
MI, 16. April 2001
|
Manfred Hulverscheidt :
Wenn ich Ihre verschiedenen Artikel richtig gelesen
habe, dann gehen Sie viel weiter als auf das 19. Jahrhundert
zurück, um das Phänomen Elektrizität als kulturellen
Faktor unserer Gesellschaft begreiflich zu machen.
Father
John Staudenmaier: Ich neige dazu, Elektrizität
in einem breiteren kulturellen Kontext zu sehen; man kann
sagen: im Kontext der Leute, die es lohnenswert fanden, ihr
Geld und ihr Können, ihre Zeit und ihre Energie in elektrische
Forschung und Entwicklung zu investieren. Ich denke natürlich
besonders an das 19. und 20. Jahrhundert. Diese Leute sind
nicht zufällig dazu gekommen, oder vielleicht sollte
ich es anders ausdrücken: man könnte deren Motivation
und Sorge um elektrische und später dann elektronische
Systeme besser nachvollziehen, indem man sich fragt: ‚Was
in der Kultur Europas - insbesondere Nord- und Westeuropas
- hat bei den Leuten eine solche Vorliebe für diese Art
von Technik erzeugt?
|
MH: Worin
bestand diese Vorliebe?
FJS:
Ich denke insbesondere an die sich allmählich
offenbarende Geschichte der Aufklärung des 17. und 18.
Jahrhunderts. Achten Sie auf die führenden intellektuellen
Köpfe Europas ungefähr nach dem 30jährigen
Krieg, also die Zeit Descartes‘, dann Leibniz' und Newtons.
Sie werden ein wachsendes Mißtrauen gegenüber dem
Sinnlichen, Erfahrungsmäßigen, Regionalem, Topischen
finden. Diese werden als verdächtig und enttäuschend
eingeschätzt, und so suchte man nach einer Art neuem
Bezugsrahmen für zuverlässiges Wissen und zuverlässige
Politik. Einige behaupten, es läge an dem Gemetzel des
30jährigen Kriegs, in dem die Leute aus religiösen
Motiven über viele Jahre fürchterliche Untaten an
sich und ihren Kindern begingen und daß sie darum nicht
mehr die Kraft besaßen zu glauben, man könne das
Lokale, Sinnliche, Persönliche, das auf beschränkter
Erfahrung Beruhende in der öffentlichen und politischen
Welt unter einen Hut bringen.
|
|
|
Man fragte sich also: gibt es nicht irgendeinen Weg, eine Welt
zu schaffen, die gesäubert ist von Leidenschaften, Vorlieben,
Übertreibungen usw. Und auf der Grundlage dieser Suche
entsteht nach meiner Ansicht der kulturelle Rahmen für
die Investitionen zum Beispiel in Präzisionsinstrumente;
- um etwas fein säuberlich ausmessen zu können, damit
die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen scharf und genau
definiert sind: 'Ah! das ist es, was uns irgendwie befreit von
diesem Gemetzel, diesen Schlächtereien!' Diese Mentalität
ist meines Erachtens den großen Investitionen vorausgegangen,
die wir mit dem Begriff industrielle Revolution beschreiben,
die begleitet war von großen Durchbrüchen bei wissenschaftlichen
Präzisionsmeßgeräten. Vielleicht kann man behaupten,
daß die intellektuellen Eliten Europas sich vor der Dunkelheit
fürchteten und sagten: es muß einen Weg geben, die
Dunkelheit zu besiegen. Denn die Dunkelheit ist schlecht, das
Dunkle, Emotionelle, Sentitive, Erfahrungs- und Ad hoc-Mäßige
|

Puppenstubenmodell
von Michael Faradays Werkstatt
(Royal Institution, London) |
Also
ich neige zu der Behauptung, daß all diese Forschungen,
die zur Elektrifizierung geführt haben, aus diesem kulturellen
Kontext hervorgegangenn sind, der besagt, daß Präzision
das Ungefähre überwinden soll.
|
MH: Kehren
wir heute in ein Zeitalter der Dunkelheit zurück?
FJS:
Oja, ich denke, Sie können das sehen
seit, ich nehme an, seitdem die Euphorien, die noch den Zweiten
Weltkrieg begleiteten, allmählich aus der Wirklichkeit
verschwanden - sagen wir irgendwann so ab 1970 . Da kann man
eine steigende Zahl von Leuten ausfindig machen, vor allem
junge, aber nicht ausschließlich junge Leute, die sagen:
es muß noch etwas anderes geben als das scharfe, klare,
strategische, systemorientierte Denken, da muß es mehr
geben als das. Und so finden Sie alle möglichen Kultbewegungen,
darunter einige ziemlich grimmige, fast geisteskranke; dann
aber wiederum andere, die sich zurückbesinnen auf mystische
Weisheiten sowohl östlicher als auch westlicher Provenienz.
Es ist keineswegs zufällig, daß der Buddhismus
heutzutage im Westen wesentlich populärer geworden ist
als er noch vor 50 Jahren war. Ich glaube keineswegs, daß
das ein Zufall ist. Ebenso ist es kein Zufall, daß die
christliche Tradition klösterlicher Versenkung, das Festhalten
am Rhythmus der Tageszeiten in den Büros der christlichen
Institutionen heute wieder viel populärer geworden und
von viel mehr Menschen getragen wird als sagen wir vor 50
Jahren. Diese Dinge legen uns nahe, daß die Vorstellung,
die Gesellschaft sei in der Lage, ihren letzten Sinn und Zweck
und ihr Glück in immer präziseren und feinabgestimmteren
Systemen wachsender Komplexität zu finden, daß
also Systeme, von denen wir abhängig sind, den ganzen
Sinn des menschlichen Fortschritts ausmachten, - daß
diese Anschauung den Leuten immer verdächtiger vorkommt.
|
MH: Hat
dieser Zweifel eine ähnliche Kraft wie der Enhusiasmus
eines Thomas Edison, Werner Siemens, Walter Rathenau?
FJS:
Eine sehr gute Frage, ob dieses Interesse,
das in an all diesen kleinen kultähnlichen Gruppierungen
zum Ausdruck kommt, dieses wachsende Interesse am Mystischen
und Kontemplativen, ob es sich dabei um eine genuine kulturelle
Bewegung handelt oder um ein Randphänomen. Man kann sicherlich
sagen, es ist klein verglichen mit diesem großen Elefanten,
den das Projekt der Aufklärung darstellt. ... Ich bin
beeindruckt von diesem enormen Engagement, das diese Gesellschaft
voraussetzt, daß ich Bürger einer Gesellschaft
zunehmender Präzision, zunehmender Vorhersagbarkeit,
Klarheit und Strategie bin. Ich glaube überhaupt nicht,
daß das schon vorbei ist. Aus dieser Haltung heraus
beobachte ich die Entwicklung von Leuten, die nach etwas Ausschau
halten, was mehr ist als das. Es ist noch zu früh, über
diese ein Urteil zu fällen.
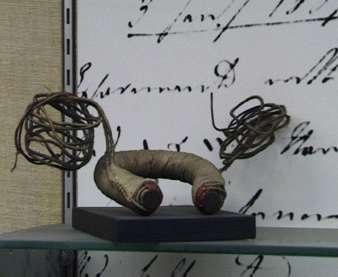
|
|
MH:
Bringt
die Elektrizität eine eigene nicht hinterfragbare Werteordnung
mit sich?
FJS:
Ich würde das nicht so sehen. Ich
würde das so angehen wie vorhin. Ich persönlich
neige nicht zu einer Interpretation, die z.B. sagt: Hier haben
wir die Stromversorgung seit sagen wir ungefähr 1880.
Sie wurde Allgemeingut, als um 1930 die meisten Haushalte
des Westens über genügend Geld verfügten, ihr
Haus zu elektrifizieren. ... Ich würde nun nicht behaupten,
daß all diese elektrischen Systeme und Geräte eine
entsprechende Mentalität erschaffen. Ich würde das
Wort „erschaffen“ nicht gern in einem solchen Satz
verwenden. Ich würde eher sagen, daß die gleiche
Mentalität, die all diese Investitionen in die Forschung
und Entwicklung über einen so langen Zeitraum hervorgebracht
und sie für so viele Leute hat wichtig werden lassen,
- daß diese Mentalität jetzt sicherlich entwickelt
und verstärkt wird durch die Möglichkeiten, die
die Elektrizität den Leuten an die Hand gibt, zweifellos.
Sie macht einige Verhaltensweisen etwas leichter und andere
etwas schwieriger, und so wird es die Leute sicherlich mit
der Zeit beeinflussen, ja. Die Leute besaßen bereits
vorher eine gewisse Mentalität. ...
Dennoch, wenn Sie mich fragten: gibt es einen Langzeiteinfluß
auf die Art und Weise, wie die Menschen ihr Leben einschätzen
aufgrund elektrischer Lichtverhältnisse, oder weil es
sehr gute Lichtverhältnisse rund um die Uhr gibt, dann
könnte man da eine ursächliche Beziehung ausfindig
machen und in Frage stellen, und das tue ich. Sie könnten
sagen, daß alle Kulturen vor der Elektrifizierung sich
mit einer Zeit schlechten Lichts abfinden mußten, nennen
wir es Nacht, mit der jeder zu tun hatte bis auf die sehr
reichen Leute, die sich viele Kerzen leisten konnten.

Aber
für die große Masse der Menschen war klar, daß
die Welt in Zeiten guten Lichts und Zeiten schlechten Lichts
eingeteilt war. Und darum wußte jeder, daß es
bestimmte Dinge gab, die man bei gutem Licht und andere, die
bei man weniger gutem Licht verrichtete, und einige Dinge,
die man des Nachts tat, funktionierten bei gedämpftem
Licht besser als bei hellem Licht. So haben die Leute ohne
lange nachzudenken verstanden, daß es Dinge des Lichts
und Dinge der Dunkelheit gibt und daß man lernen muß,
mit beiden gut umzugehen, einfach weil sie uns täglich
begleiten.
Was geschieht also in einer Kultur, die gar nichts mehr mit
schlechtem Licht zu schaffen hat, vielleicht sogar für
immer? Was geschieht mit den Dingen des gedämpften Lichts,
die die Leute bis dahin für selbstverständlich hielten?
Ich denke an die Sachen, welche die Leute des nachts taten,
schlafen, ausruhen, träumen, Geschichten erzählen,
Sex oder nur so herumsitzen und nichts planen und nicht angestrengt
nachdenken. Was geschieht mit diesen ganzen Aktivitäten
in einer Kultur, in der man jederzeit die Dinge des Lichts,
also scharf fokussierte Arbeit leisten kann, um Mitternacht
oder um drei oder fünf Uhr morgens. Ich hab' da so meine
Fragen.

Ich
frag‘ mich z.B, wieso die Leute so leichtfertig annehmen,
sie müßten fähig sein, sich schnell Klarheit
zu verschaffen. Daß sie Unklarheit, Zweideutigkeit,
Ungewißheit immer nur als Defekte betrachten und nicht
als ganz normale Erscheinungen. Ich glaube, das ist eine Tugend,
die uns in dieser Gesellschaft abhanden gekommen ist: daß
wir ungeduldig sind mit Ambiguität, mit Unklarheit und
dem, was wir nicht vorhersehen können. Darin sind wir
nicht sehr gut. Das mögen wir nicht. Und irgendwie haben
wir das vage Gefühl, etwas sei Schuld, wenn wir uns unsicher
fühlen. Falls ich da richtig liege, ist diese Eile nach
rascher Klärung nur ein eiliges Vorbeihuschen an einer
wesentlichen Dimension des menschlichen Bewußtseins,
die darin besteht, sich von einer Zeit der Klarheit zu einer
Zeit der Ungewißheit zu bewegen, durch eine Zeit der
Unsicherheit hindurch, bis sich wieder Klarheit einstellt.
Wir sind vielleicht darin nicht so gut, wenn wir über
die Beziehungen reden, die wir miteinander pflegen, über
langfristige Politik, über gemeinsame Strategien. Wahrscheinlich
zucken wir bei unsicheren Aussichten zusammen.
Ich denke, das könnte eine Wirkung von Technik sein.
|
|
MH:
Finden Sie es schlecht, daß
die Medien z.B. dieses nächtliche Geschichtenerzählen
für uns übernommen haben?
FJS:
Also ich persönlich neige dazu zu
sagen, daß jede Kultur zu jeder Zeit ihre angenehmen
Seiten wie ihre Versuchungen besitzt, ihre eigenen Regeln
und Verbindlichkeiten. Und ich würde niemandem raten,
sich allzusehr den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er
besser oder schlechter dran ist als ein Mensch, der vor tausend
Jahren gelebt hat. Trotzdem ist es nicht unklug, sich Gedanken
über die Regeln und Verbindlichkeiten der Zeit, in der
man lebt, zu machen. Und ein Weg, darüber nachzudenken,
führt über den Vergleich mit anderen Perioden. Man
sollte sich schon fragen: was sind die Dinge, die uns heutzutage
ein nobles, reiches, freundliches, warmes, verspieltes Leben
ermöglichen, im Vergleich zu den Zeiten von vor tausend
Jahren? ... Eine Sache, die wir Bürger des späten
20. und beginnenden 21. Jahrhunderts hoch ansetzen dürfen,
sind die schöpferischen Möglichkeiten der Systeme,
die uns heute zur Verfügung stehen. Das schließt
Transport-, Medien- und wissenschaftliche Systeme ein. Ich
denke, daß die Menschen heute in der Lage sehr weit
abheben, also auf einem Niveau kreativ sind, das sie sich
vor tausend Jahren nicht haben vorstellen können.
So könnten Sie einwenden, daß die Gabe des Sinnes
für Möglichkeiten, welche zu einem wichtigen Bestandteil
des gegenwärtigen Lebens geworden ist, ein Ergebnis der
Präzision von elektrischen Systemen ist, - und der Tatsache,
daß diese Systeme ständig verstärkt und verbessert
werden und wir dauernd damit beschäftigt sind, uns den
Fähigkeiten dieser Systeme anzupassen. Sie könnten
einwenden, daß damit eine andauernde Stimulation unserer
Einbildung einhergeht, was schrecklich wäre. Ich glaube,
das sehe ich auch so. Sie könnten auch einwenden, daß
wir darum Opfer von Überfütterung sind. Da gibt
es einen Menschen vom MIT, dessen Name ich vergessen habe,
der das DATA SMOG nennt. Und wir sind alle damit belastet
und wissen es. Wir wissen alle, daß wir zuviel Informationen
bekommen, daß wir abstumpfen und zynisch werden und
wir nicht sicher sind, wo wir in diesem Leben, das wir führen,
Ruhe finden sollen. Das ist eine der Lasten dieser Welt. Aber
beim Vergleich der Welt vor mit der Welt nach der Elektrifizierung
sollten wir nicht wehmütig werden.

|
|
MH: Dennoch frage ich
Sie: gibt es nicht eine wirklich tiefgehende kulturelle Wirkung
der Elektrizität, die unsere Körper und unser tägliches
Leben betrifft?
FJS:
Wissen Sie eine Sache, die für alle
elektrischen Systeme gilt, ist dieser radikale Unterschied
zwischen der Bewegung in Lichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit
von Körpern. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und
da hat sich mit dem Auftreten elektrischer Systeme wirklich
etwas geändert, worüber man auch mal nachdenken
sollte, also fragen: in welchem Maße bewegen sich menschliche
Organismen, also wir und unsere Körper auf wahrnehmbare
Weise in der Geschwindigkeit des Blutes. Wir bewegen uns mit
dem Tempo des Blutstroms, der unsere Körper durchfließt,
während unser Nervensystem auf die Außenwelt reagiert
und wir bewegen uns im Rhythmus unserer Hormone. Das ist die
Art, wie sich das menschliche Tier bewegt und denkt und fühlt
und schmeckt und Entscheidungen trifft. Aber ein sehr großer
Teil der Welt, in der wir jetzt leben, bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit.
Ob wir nun über Kommunikationssysteme sprechen, die mir
erlauben, mit jemandem in Europa so zu reden, als säßen
wir uns am Tisch gegenüber oder wir über ein sehr
komplexes elektrisches Energieverteilungsnetz sprechen , das
den Leuten erlaubt, ihre Wünsche als Daten ins Netz einzugeben,
aus dem andere wiederum ihre Güter beziehen, so daß
es keine Ausfälle gibt. Diese Art von Informationsbewegung
oder sprechen wir von einer elektronischen Datenbank, die
in der Lage ist, ausgehend von einem kleinen Verkehrsvergehen
mein gesamtes Strafregister bis zu der Tatsache zurückzuverfolgen
daß ich in Conneticut gesucht werde, während ich
in Wisconsin bloß eine rote Ampel übersehen habe.
Diese Dinge haben alle dies gemeinsam und zwar, daß
nur, weil wir Zeichen mit Lichtgeschwindigkeit durch die verschiedensten
Medien jagen können, wir auf diese Weise viele Sachen
wesentlich schneller erledigen können als jemals zuvor.
Und ich denke, eine der wirklich wichtigen Fragen, über
die man sich Klarheit verschaffen sollte, ist die folgende:
Wie schaffen es Leute, deren Körper der Sitz ihres Bewußtseins
ist, wie schaffen sie es, die Lichtgeschwindigkeit durchzuhalten,
in ihren vernetzten Beziehungen informeller Datenübertragung.
Da sind m.E. eine Menge interessanter Fragen zu klären.
|

MH: Worin
lag dann der nennenswerte Vorteil einer nicht völlig elektrifizierten
Welt?
FJS:
Ich denke, ein bemerkenswerter Wandel zwischen
einer Welt ohne Strom und der gegenwärtigen Welt betrifft
die Tatsache, daß jedermann reichlich „Abhäng-Zeit“,
Ruhezeit, nutzlose Zeit hatte, weil darin die Nacht bestand.
Wir sind damit nicht mehr gesegnet und vielleicht müssen
die Leute deshalb, um eine Balance in ihrem Leben zu finden,
sich auf irgendeine Weise geschützte Zeiten schaffen,
Zeiten mit klaren Grenzziehungen, typischen rituellen Grenzen,
innerhalb derer sie sich nicht mehr zweckgerichtet verhalten,
wo sie nicht so eine Eile haben. Ferien, im Westen ein relativ
neues Phänomen, sollten einmal so etwas sein. Nicht jeder
kriegt das natürlich so hin. Sie nehmen Ferien und verhalten
sich dabei genauso strategisch wie sonst auch, aber die Idee
der Ferien war, aus meinem Leben herauszutreten. Wir sollten
die Zeit einfach nehmen und beschützen und unser Mobiltelefon
nicht zum Strand nehmen. Wir haben Zeit, wenn wir nicht unterbrochen
werden können. Einige Leute kriegen das hin, andere weniger.
Es gibt Mobiltelefone am Strand, aber daran können sie
die Herausforderung des Erwachsenwerdens in unserer Kultur
ermessen, nämlich als eine Herausforderung, Zeiten freizumachen,
innerhalb derer Entscheidungsprozesse den Rhythmus bestimmen
und wo wir nicht derart vernetzt sind, nicht so sehr mit Informationsverarbeitung
beschäftigt sind.
|
|
MH: Haben Sie das bereits praktiziert, was sie vorschlagen?
FJS:
Nein, ich finde das keineswegs einfach. Ich finde, es ist
eine der Herausforderungen an das Erwachsenwerden. Ich habe
in meine Woche jeden Sonntag abend zusammen mit vier anderen
Jesuiten, mit denen ich hier zusammenlebe, 90 Minuten eingestreut,
die nennen wir Erzählstunde. Und wir erzählen uns
einfach nur, wie die Woche war, das Auf- und Ab der Stimmungen.
Aber wir erzählen jetzt keine dicken Geschichten, wir
erzählen kleine Geschichten. Ich finde, wenn man keine
Foren mehr hat, innerhalb derer man unwichtige Geschichten
erzählen kann, werden überhaupt keine Geschichten
erzählt und die Leute fühlen sich fremd, weil niemand
mehr den kleinen Dingen zuhören will. Wenn ich nach Hause
komme und sage, mein Doktor hat mir erzählt, ich hätte
Krebs und werde in zwei Wochen sterben, wird jeder meiner
Geschichte hören wollen. Diese Story wird für eine
gewisse Zeit bei anderen Leuten einschlagen. Wenn ich jedoch
nach Hause komme und sage, da fuhr jemand neben mir auf der
Autobahn, der schaute so bedrückt aus der Wäsche,
daß ich selbst traurig war, als ich weiterfuhr. Das
ist so eine nette kleine Geschichte. Könnte man die erzählen,
während wir alle beschäftigt sind? Wahrscheinlich
nicht. Aber wenn wir uns nicht gegenseitig eine Zeitlang unwichtige
Geschichten erzählen, geht uns etwas verloren. ... Das
ist ein wesentlicher Bestandteil des Erwachsenseins und wenn
ich da richtig liege, dann müssen die Leute einen Weg
dafür finden, trotz Mobiltelefon, Piepern und den Börsennachrichten
von Hongkong auf meinem Palm-Pilot. Manchmal muß ich
diese Dinge beiseiteschieben und Platz schaffen.
|
|
MH: Kann
man darum von einer geradezu zwanghaften Vernetzung sprechen,
die mein Leben gängelt, wo ich es nicht mehr führe?
FJS:
Ich denke über die Differenz nach
zwischen dem Leben in einer vernetzten, elektrifizierten Welt,
wo mein Rhythmus vom System bestimmt wird, und den Teilen
meines Lebens, in denen ich es geschafft habe, anders zu leben.
Ich denke, daß ich - im Falle einer vernetzten Mentalität
- nach jeder sich bietenden Möglichkeit Ausschau halte
und versuchen werde, keine einzige davon auszulassen. Meine
Informations- und Kommunikationssysteme sind somit ständig
in Bereitschaft, um mich so schnell und angepaßt wie
möglich in ihnen zu bewegen.

Ich
versuche dagegen Zeiten in meinem Leben freizumachen, wo ich
keine Lust habe, Informationen zu verarbeiten, sondern stattdessen
selbst anwesend sein will. Wo ich mich nicht im Takte der
Uhr bewege, wo ich dem Ablauf der Zeit überhaupt keine
Beachtung schenke und es schaffe, meinen Weg innerhalb des
gerade ablaufenden Ereignisses zu finden, wo mir also dieses
Ereignis die Zeit ansagt und nicht die Uhr. Ich glaube, jeder
kennt diese Augenblicke, wo man sagt „vergiß‘
die Zeit!“ - und ich glaube nicht, daß wird dann
die Zeit vergessen, sondern daß wir in solchen Augenblicken
einen anderen Rhythmus haben. Das Ereignis sagt uns, daß
sie noch nicht um ist, daß wir die Unterhaltung fortsetzen
müssen oder die Party noch nicht vorüber ist oder
daß das Buch in meiner Hand mich derart gepackt hat,
daß ich voll und ganz in seine Lektüre vertieft
bin und für einen Moment den Bezug zur Uhrzeit verloren
habe.
Ich besitze Uhrzeit im Übermaß. Die meiste Zeit
meines Lebens bin ich regelrecht programmiert und verhalte
mich strategisch, und ich glaube, ich bin darin ein ganz gewöhnlicher
Erwachsener. Nur durch Pausen gewinne ich Zeit. Manchmal pausiere
ich sogar inmitten eines geschäftigen Tages und versuche,
Dingen, die passieren, meine Aufmerksamkeit zu schenken, Dingen,
die nicht auf meinem Zeitplan
stehen. Ich habe da einiges durch den Kodex eines Volkes gelernt,
den Lakota, mit dem ich eine Zeit zusammengelebt habe; es
ist mehr eine innere Einstellung und ein Gefühl für
Pausen. Wenn ich zum Beispiel über eine Grasebene laufe
und richtig zu pausieren weiß, kann ich die verschiedenen
Töne des wachsenden Grases hier hören, die Töne
eines wachsenden Baumes hier, oder eines anderen dort. Und
wenn ich diesen Punkt, diesen inneren Zustand erreiche, in
dem ich mich auf die Frequenzen des wachsenden Grases konzentriere
und sie von denen eines wachsenden Baumes unterscheiden kann,
dann bin ich für einen Augenblick aus meinem Rahmen herausgetreten
und bin etwas gesünder, wenn ich wieder zu mir komme.
Ich habe dann meine eigene Zeiteinteilung relativiert. Ich
denke, eine Menge anderer Leute tun bereits das gleiche.
|
|
MH:
Sehen Sie auch außerhalb Ihrer eigenen Lebensführung
eine gesellschaftliche Chance, diesen permanenten "stand-by-modus"
zu überwinden?
FJS:
Ich gebe ganz gewöhnlichen Leuten
eine Reihe von Kursen über Elektrizität und meine
gewöhnliche Erfahrung dabei ist, daß viele gar
kein scharfes Bewußtsein über ihre Beziehung zur
Elektrizität besitzen. Aber ihre Gefühle über
Elektrizität sind sehr nahe bei der Sache und können
kaum beeinflußt werden. Die Leute haben ein sehr genaues
emotionales Einfühlungsvermögen, ich denke sowohl
im Hinblick auf ihr Gefühl für die sich bietenden
Gelegenheiten wie auch für die Kommandogewalten, die
ihnen die elektrische Technologie bietet. Ich denke an diesen
Sinn für Macht und Energie. Aber die Menschen haben auch
ein gutes Gefühl für dieses Getriebensein und die
Gefahren, sich in den einzelnen Schritten zu verlieren. Sie
verstehen beides auf Anhieb, sobald man ihnen das bewußtmacht.
Das ist eine sehr spannende Sache. Ich denke, das gilt auch
für Autos, für Computer, inzwischen glaube ich sogar
für Nahrung und bald für Wasser. Ich meine, die
meisten Leute wissen gar nicht, wie emotional ihre Beziehung
zu Wasser-Systemen ist, also Wasser aufzubereiten und zu verteilen
und so weiter. Ich glaube, daß die Wirkungen von Elektrizität
und Autos den Leuten immer noch sehr viel bewußter sind
als die von Nahrung und Wasser, obwohl uns da heutzutage schon
vieles bewußter geworden ist. Aber ich habe das Gefühl,
daß wir Bürger des 20. und 21. Jahrhunderts allesamt
sehr emotionale Beziehungen zu all diesen Technologien unterhalten,
aber es ist schwierig, diese Beziehung für uns selbst
in die richtigen Worte zu fassen und dabei einen Schritt innezuhalten
und über sie nachzudenken. Das ist eine Sache, die ich
sehr gern tue: ich mag es, hilfreiche Worte zu finden, die
es Leuten ermöglicht, ihre eigenen Erkenntnisse über
die Technologien zu artikulieren, die für ihr Leben wichtig
sind.

|
|
MH:
Wie schätzen sie Möglichkeiten ein, elektrische
Systeme z.B. für kontemplative Praktiken, also das genaue
Gegenteil von zweckgerichteten Aktivitäten, einzusetzen?
FJS:
Ich denke manchmal, daß die Leute
Elektrizität als eine kontemplative Dimension ihres Lebens
betrachten. Und manchmal, daß einige, besonders junge
Leute, die gern mit Bildern spielen und deren Potentiale ausreizen,
falls sie genug Speicher für Bilder und Bildkombinationen
haben, daß die da etwas kontemplatives tun, was man
ein Spiel mit der Einbildungskraft nennen kann. Ich will gar
nicht darauf hinaus, daß Elektrizität unbedingt
zerstreuender sein müßte als im Dunkeln abends
um acht bei einem Feuer zu sitzen. Du kannst abschalten und
vom Leben abkoppeln. Ich finde, Erwachsene sollten zerstreut
werden, und es ist ein Teil unserer Lebensdisziplin zu lernen,
wann zerstreut zu sein gut ist und wann man sich lieber auf
etwas konzentrieren soll, oder wann man dieses oder jenes
tun sollte, wann Zerstreuung destruktiv ist und wann sie bloß
erholsam ist. Das sind wichtige Fragen und ich denke, es wäre
gesund, mit ihnen die Art unserer Beziehungen zu elektrischen
Systemen abzuklären.
|
|
Manfred
Hulverscheidt: Zum Schluß noch
eine Frage zur Zukunft hochtechnologischer Systeme. Werden
diese angesichts schwindender Ressourcen nicht eher in einer
Katastrophe münden als in einer Transformation?
Father
John Staudenmaier: Sie
meinen, ob es einen katastrofischen Ausgang der Spannungen
eines Systems geben wird? Ich weiß nicht, ob da zum
gegenwärtigen Zeitpunkt eine korrekte Vorhersage möglich
ist. In vielen Bereichen der Welt wächst der Druck. Die
Menge des Stromverbrauchs ist einer davon. Die wachsende Müllmenge,
die die verschiedenen Systeme der Menschen produzieren, sind
auch sehr bedrückend. Die Knappheit von sauberem Trinkwasser
gehört dazu. Aber was aufgrund dieses Drucks wirklich
passieren wird, kann man derzeit noch nicht wissen. Mir scheint,
es könnte ziemlich übel werden. In einigen Teilen
der Welt ist es bereits sehr übel. Die große Ungleichheit
in der Welt ist nicht die digitale Scheide, es ist das Wasser,
die Trinkwasserscheide, denke ich.
MH: Father John, ich danke
für dieses Gespräch.
|
|
|
|
Copyright
©
2001-2002, HDTVideo, eine Manfred Hulverscheidt Internetseite. Alle Rechte
vorbehalten.
Gestaltung:
seamean@yahoo.com
|